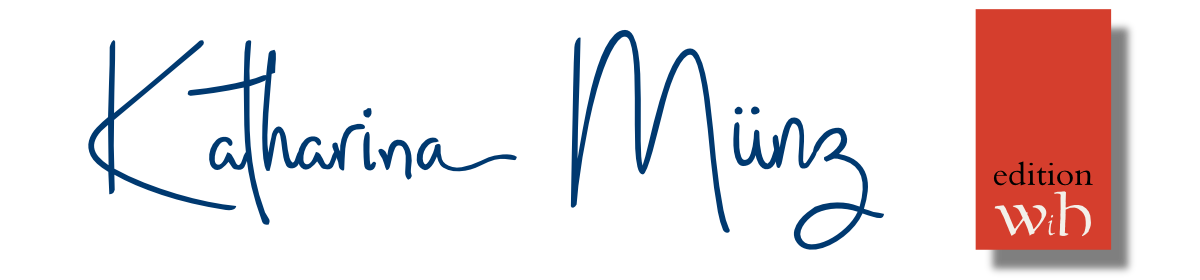Aktuell wird in der Autorenszene ja viel diskutiert über das, was insbesondere Liebesromane sollen – und was nicht.
Und welche (teils dramatische, geradezu selbstzerstörerische) Auswirkungen gewisse Rollenbilder in diesen Romanen auf das reale (Seelen)Leben der Leserinnen hätten.
Meiner Meinung nach wird die Macht dieser „bösen Bücher“ bei dieser Betrachtung grenzenlos überschätzt.

Den Psychologie-Professor Jordan B. Peterson habe ich bereits mehrfach auf meinem Blog zitiert (im Artikel Interna aus dem Autorenleben | Moral-Lehrstunde für Autoren und in der Buchvorstellung | Anabelle Wildbuch: Bad Boss Xmas). Er sagt aber auch immer so kluge Sachen und das auch noch so überaus witzig und charmant – deshalb unbedingt seine Videos ansehen!
In der aktuellen Diskussion geht es unter anderem darum, dass es mehr „Diversität“ in Liebesromanen geben müsse. Es werden Protagonistinnen gefordert, die sich in Männer verlieben, die kleiner sind als sie selbst, die einen weniger qualifizierten Job ausüben und ja, hässlich und hühnerbrüstig sollen sie am besten auch noch sein.
Welche Rolle spielen Frauen im Verhältnis zu Männern? Nun zunächst einmal verunsichern sie die Männer, das sollte man sich immer vor Augen halten. Ich würde sogar sagen, dass die primäre Rolle, die Frauen im Umgang mit Männern spielen, die ist, sie zu verunsichern. Und Männer mögen das nicht unbedingt.
112-Peterson: Und raus bist du
… so beginnt das überaus lesenswerte Transkript von Jordan B. Petersons Vortrag „Biblical Series IV: Adam and Eve: Self-Consciousness, Evil, and Death“
Grob verkürzt, entspricht seine Erklärung nicht nur dafür, weshalb wir Menschen uns so paaren, wie wir das tun (und weshalb logischerweise dann auch Bücher über menschliches Paarungsverhalten, vulgo „Liebesromane“, diese Norm abbilden), sondern sogar, weshalb wir uns vor ungefähr 6 Millionen Jahren von den Schimpansen abgespalten haben, der griffigen Aufforderung:
Cherchez la femme!
In einer Diskussion zum Thema in einer Autorengruppe schrieb ich folgendes:
Im Endeffekt geht es darum, zu verstehen, dass in uns drin Verhaltensmuster genetisch programmiert sind, die auf Jahr(zehn)tausende alten Erfolgsgeschichten basieren.
Ich lese sehr gern entsprechende, durchaus populär aufbereitete Sachbücher wie Desmond Morris‘ „The Naked Ape“, Richard Dawkins‘ „The Ancestors Tale“, aber auch eher schwere Kost wie Sarah Blaffer Hrdys „Mother Nature“.
Bei der Lektüre wird einem bewusst, dass wir unter der dünnen Tünche der Zivilisation immer noch jene Säugetiere sind, deren Sozialverhalten auf ein Überleben in Kleingruppen mit 10 bis maximal 30 Mitgliedern in rauer Natur ausgerichtet ist, die nur selten in Kontakt zu anderen Gruppen von Artgenossen kommen.
Die Steinzeitfrau, die den untergroßen Typen mit verschieden langen Beinen und Sehfehler auswählte, hatte deutlich geringere Aussichten, den gemeinsamen Nachwuchs großzuziehen, als ihre Kollegin, die ihre Möglichkeiten nutzte, um auch nur die Dritt- oder Viertfrau des (in jeder Hinsicht) potenten Anführers zu werden.
Dieses Paarungsverhalten ist nicht nur verhaltensbiologisch erklärbar, sondern hat, wie jüngste Untersuchungen zeigen, auch tiefgreifende Spuren in unserem Genom hinterlassen.
James B. Peterson kommt zum gleichen Schluss – nur schreibt er das natürlich erheblich eleganter:
Frauen haben Kinder, und Kinder machen die Frau abhängig, und die Frau sucht … aus einer evolutionären Perspektive nach jemandem, der nützlich genug ist, ihr dabei zu helfen.
112-Peterson: Und raus bist du
Deshalb stellen Frauen enorme Anforderungen an Männer, und das sollte nicht überraschen.
Und genau … dieser Selektionsdruck, den Frauen den Männern aufzwangen, hat die gesamte Spezies entwickelt.
Kurz gesagt:
Die Frau als Triebfeder
der (menschlichen) Evolution.
Und diese enorme Leistung sollen wir jetzt gerade in Büchern, die sich in erster Linie an Frauen richten, aus irgendwelchen „emanzipatorischen“ Gründen in die Tonne treten?
Na, irgendeinen hässlichen Dummdödel lass ich schon im realen Leben nicht in mein Bett – weshalb, bei Lokis Lachs, sollte ich dann meine Protagonistinnen damit strafen?
Nee, hübsch sollen sie schon sein, sportlich gestählt und großgewachsen …
Wohlgemerkt: Es geht mir keinesfalls darum, aus meinen Protagonistinnen verhuschte Hascherl zu machen, die (in Ermangelung eines Rapunzel-Turms) hoch droben auf einem Baum sitzen und darauf warten, dass ihr Märchenprinz auftritt und sie pflückt. Nur ja nicht den ersten Schritt wagen und runterspringen, weil sich ein ansehnlicher Kerl nähert – mit „Fallobst“, das der edle Recke vom Boden auflesen muss, will der ja nichts zu tun haben! (Dieses Bild hat mir eine junge – durchaus intelligente und sympathische – angehende Schriftstellerin gemalt, als wir beim gegenseitigen Probelesen auf die Thematik zu sprechen kamen.)
Nein! Meine Heldinnen sind stark. Sie küssen den Mann zuerst, machen ihm gar einen Antrag, ohne dass ihnen eine Zacke aus dem Prinzessinnen-Krönchen bräche!
Sie sind sich ihrer Verletzlichkeit aber auch überaus bewusst, weshalb sie – geprägt von schlechten Erfahrungen – sich ganz bewusst für Männer entscheiden, die „nützlich“ sind.
Dabei geht es, bei Freyas Katzengespann, nicht um ebenso finanzstarke wie bindungsunfähige Arschlöcher vom Schlage eines Mr. Größere-Anzahl-monochromer-Schattierungen. Dass die jungfräuliche Elfe den zu einfühlsamem Sozialverhalten zähmt, gehört definitiv ins Teich der Märchen (und nicht der Sagen und Legenden mit wahrem Kern).
Nein! Es geht um Männer, die genau wie meine Protagonistinnen begriffen haben, was ihre Rolle im großen Spiel des Lebens ist:
Die Evolution gab den Männern Stärke, damit sie ihre Frauen schützen.
Und wenn AutorInnen (ich meine diejenigen, die gerne dieses depperte Binnen-I benutzen), glauben, dass sie durch Handlungsanweisungen an Autorenkollegen bezüglich der Gestaltung elementarer Kernpunkte von Liebesromanen gesellschaftliches Verhalten ändern könnten – dann glauben sie wohl auch, dass eine iOs-App auf ihrem Android-Smartphone liefe …